In ihrem programmatischen Essay 11 Theses on Needs haben Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt – anknüpfend an Adornos Thesen über Bedürfnis – Ansätze einer zeitgenössischen kritischen Theorie der Bedürfnisse skizziert. Darin argumentieren sie, dass Bedürfnisse nicht vorpolitisch gegeben, sondern gesellschaftlich vermittelt sind und durch Unterdrückung und Ausbeutung geprägt werden. Statt einer substanziellen Kritik ‚falscher‘ Bedürfnisse sollten daher die Bedingungen problematisiert werden, unter denen Bedürfnisse erzeugt, artikuliert und befriedigt werden. Anstatt von vermeintlichen Grundbedürfnissen auszugehen, plädieren die Autor:innen für eine Kritik und Transformation von Bedürfnissen im Rahmen einer ‚radikaldemokratischen Politik der Bedürfnisse‘, die die freie und gleiche Teilnahme aller an kollektiven Prozessen der Bedürfnisformation in den Mittelpunkt stellt. Einen politischen Bezug auf kontextübergreifende Grundbedürfnisse lehnen sie hingegen als potenziell autoritäre Sackgasse ab. In der folgenden Replik unternehmen wir den Versuch, den Bedürfnisbegriff vor einer solchen Denaturalisierung und Formalisierung, in der die Prozesse der Bedürfnisformation und nicht die Bedürfnisse selbst im Mittelpunkt stehen, zu retten und ihn als Ausgangspunkt substanzieller gesellschaftskritischer Kontestation stark zu machen.
soziale Bewegungen
Öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema „Philosophy and Activism: Epistemic Injustice, Recognition Failures, and Social Movements” (Berlin)
Am 6. Mai 2023 findet im Aquarium (Kottbusser Tor, Berlin) eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Jacob Blumenfeld, Daniel Loick, Candice Delmas, Robin Celikates and Nathan Rochelle DuFord zu den Themen soziale Bewegungen, Solidarität, Widerstand und Hungerstreik und die Rolle der Philosophie in all dem statt. Die Podiumsdiskussion wird im Rahmen des DFG Research Network „The Relation of Theories of Epistemic Injustice and Recognition Theory“ veranstaltet und von Hilkje Hänel and Fabian Schuppert (Universität Potsdam) organisiert. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht nötig. Die Türen stehen ab 17 Uhr offen, um 18 Uhr beginnt die Diskussion. Mehr Infos hier.
Benjamin-Lectures: Sally Haslanger über „Agents of Possibility” (14.-16. Juni in Berlin)
Sally Haslanger (Massachusetts Institute of Technology) wird die diesjährigen Benjamin-Lectures des Centre for Social Critique halten. In ihren öffentlichen Vorträgen wird sie am 14., 15. und 16. Juni in Berlin zum Thema „Agents of Possibility“ sprechen und dabei insbesondere auf die Komplexität sozialen Wandels und die entscheidende Rolle sozialer Bewegungen eingehen. […]
Kritische Theorie des Wandels im Wandel – ein Tagungsbericht
Revolutionen tragen ein aktives und ein passives Moment in sich; damit sie gelingen, braucht es nicht nur den guten Willen der Handelnden, sondern auch objektive Bedingungen, die einen radikalen sozialen Wandel erst ermöglichen. Dies ist das wohl anschlussfähigste Theorem des historischen Materialismus und der Revolutionstheorie von Karl Marx (vgl. von Redecker 2018: 20; Marx 1976 [1844]: 386). Das Theorem findet sich auch in der Gliederung des vom Centre for Social Critique organisierten Workshops „Change2: The Disruptions of Social Change“ wieder, der am 20. und 21. Februar in Berlin stattfand.
CfA: „Epistemic Injustice, Recognition Failures, and Social Movements“ (Potsdam & Berlin)
Vom 4. bis zum 6. Mai 2023 findet in Potsdam und in Berlin eine internationale Konferenz zum Thema „Epistemic Injustice, Recognition Failures, and Social Movements“ statt, auf deren insgesamt vier Panels soll es um das Verhältnis von Theorien der Anerkennung bzw. epistemischer Ungerechtigkeit und sozialer Bewegungen gehen. Sie wird veranstaltet von der DFG-geförderten Forschungsgruppe „The Relation between Recognition Theory and Theories of Epistemic Injustice“ – Anmeldungen sind bis zum 30. April auf der Website möglich.
Symposium: „Contested Social and Ecological Reproduction“ in Dresden
Am 23. September findet an der TU Dresden ein internationales Symposium zum Thema „Umkämpfte soziale und ökologische Reproduktion/Contested Social and Ecological Reproduction“ statt, das den Umgang unterschiedlicher politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure sowie sozialer Bewegungen mit anhaltenden multidimensionalen Krisen und der Gefährdung menschlicher Lebensgrundlagen zum Gegenstand hat. Der erste Teil des Symposiums zum Thema „Care and Supply“ findet in deutscher, die weiteren Teile – darunter auch ein Gespräch mit Nancy Fraser zu ihrem Buch Cannibal Capitalism – in englischer Sprache statt. Eine Anmeldung zu dieser öffentlichen Veranstaltung, die im Victor-Klemperer-Saal in Dresden sowie online stattfindet, ist bis zum 20. September 2022 unter constanze.stutz@tu-dresden.de möglich. Das komplette Programm mit Infos zu den unterschiedlichen Beiträgen findet sich online hier.
Solidarität über Grenzen hinweg? Die Kritik des Globalen und das reflexive Potenzial gemeinsamer Praxis
— Nach dem starken Plädoyer von Brigitte Bargetz, Alexandra Scheele und Silke Schneider für feministische Perspektiven gerade auch auf umkämpfte Solidaritäten, blickt Felix Anderl im vorletzten Beitrag unserer Solidaritäts!?-Debatte heute auf den potentiell expansiven Charakter der Solidarität im globalen Horizont. —
“Das Eins hat schlechthin nur Wahrheit als viele Eins.“ (Karl Marx)
Solidarität hat etwas Expansives. Sie reicht einer Gegenüber die Hand und erwirkt damit eine Einheit, die zuvor nicht bestand. Ihr Horizont ist globale Gerechtigkeit. Dies lässt sich gut an Institutionen wie dem Weltsozialforum zeigen, aber auch an der Entwicklungspolitik oder der Erweiterungspolitik der Europäischen Union, die auf dem Versprechen aufbaut(e), dass es – durch europaweite solidarische Politik – allen Europäerinnen einmal so gut gehen würde wie jenen im „Kerneuropa“. Dass dies nicht nur die leere Rhetorik eines neoliberalen Clubs war, zeigt sich etwa in der Verwendung von Solidarität in der Kritischen Theorie. Hauke Brunkhorst (1997, ähnlich Fraser) definiert Fortschritt als die Ausweitung der Solidarität unter Freunden auf die Solidarität mit Fremden. Die Verallgemeinerung der Solidarität in diesem Zusammenhang ist ein Prozess, in dem sich der Kreis derer, für die wir mitfühlend und verantwortlich sind, sukzessive erweitert. (mehr …)
Bewegende Solidarität – Gedanken zur Solidarität im Kontext Sozialer Bewegungen
— Nach den Überlegungen von Lukasz Dziedzic zu Solidarität in der EU eröffnet Marieluise Mühe heute in unserer Soldaritäts-Debatte eine andere Perspektive auf Solidarität – die der Sozialen Bewegungen. —
Als Demo-Slogan und als (Gegen-)Narrativ – z.B. zum Rechtspopulismus und im Kontext der Debatte um Klimagerechtigkeit – erlebt der Aufruf zur Solidarität heutzutage eine starke Konjunktur. So tragen aktuelle Bündnisse und öffentliche Appelle Namen bzw. Überschriften wie ‚Solidarität statt Ausgrenzung‘, ‚Solidarität statt Heimat‘, ‚Solidarität unter Minderheiten‘. Solidarität wird normativ als Haltung in eine spannungsreiche und fragmentierte Gesellschaft hineingetragen, die gemeinsames Handeln gegen einen politischen Kontrapunkt dringlich als Konsequenz fordert. In meinem Beitrag möchte ich eingangs einige (wenige) grundlegende Konzeptionalisierungen von Solidarität aufgreifen und mich anschließend vor allem auf die Verschränkung von Solidarität und Sozialen Bewegungen innerhalb der Protest- und Bewegungsforschung beziehen.
Solidarität sollte eigentlich ausnahmslos im Plural verwendet werden. Anders kommt die begriffliche Vielfalt, die sich in mannigfaltigen Bestimmungen, Systematisierungen, Anrufungen und Anwendungspraxen in der wissenschaftlichen Literatur und in der politischen Debatte zeigt (siehe zur inflationären Nutzung Marie Wachinger und Stefan Wallaschek hier auf dem Theorieblog), schwer zum Ausdruck. Allerdings würde die Rede von Solidaritäten vermutlich mehr Verwirrung stiften und Erklärungsbedarf einfordern als Klarheit schaffen. Zugleich würde der Aufruf zu Solidaritäten im Rahmen von Mobilisierungen eher zu Ungunsten rhetorischer Schlagkraft sowie eines gemeinsamen Verständigungshorizonts ausfallen, sondern die eindeutige Aufforderung zum Einstehen füreinander abmildern. Um die verschiedenen Formationen und Bestandteile des Solidaritätsbegriffs kenntlich zu machen und Konturen des eigenen Verständnisses zu schärfen, werden von vielen Autor_innen alternativ Labels zur Determination und Kategorisierung vergeben: Solidarität kann alt/neu, sozial/politisch, postnational/international/lokal, kosmopolitisch/kommunitaristisch, institutionell/zivil, inkludierend/exkludierend, fluide usw. verfasst oder gelagert sein. (mehr …)
Tagung „Hashtags – Tweets – Protest. Social Movements in the Digital Age“ (Berlin)
CfP: Social Movements in the Digital Age
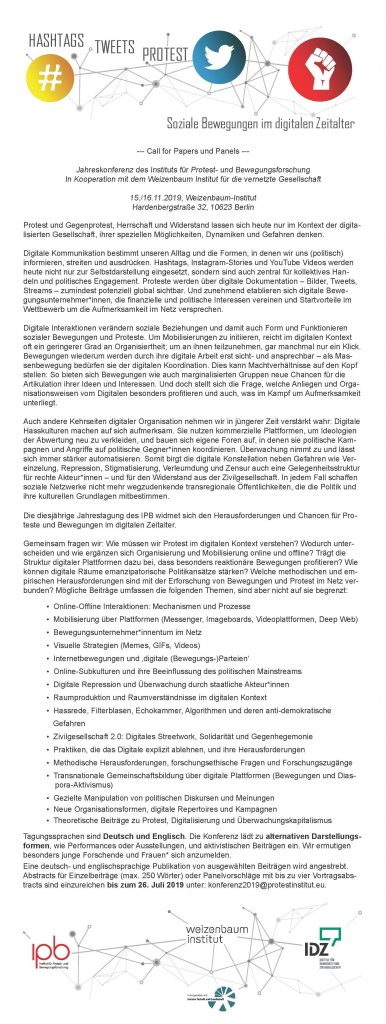 Am 15. und 16. November findet eine gemeinsam vom Institut für Protest und Bewegungsforschung und der Forschungsgruppe „Demokratie und Digitalisierung“ des Weizenbaum-Instituts ausgerichtete Konferenz mit dem Titel „Hashtags | Tweets | Protest. Soziale Bewegungen im digitalen Zeitalter“ statt. Veranstaltugnsort ist das Weizenbaum-Institut in Berlin.
Am 15. und 16. November findet eine gemeinsam vom Institut für Protest und Bewegungsforschung und der Forschungsgruppe „Demokratie und Digitalisierung“ des Weizenbaum-Instituts ausgerichtete Konferenz mit dem Titel „Hashtags | Tweets | Protest. Soziale Bewegungen im digitalen Zeitalter“ statt. Veranstaltugnsort ist das Weizenbaum-Institut in Berlin.
Neben der Frage von gewänderten Organisations- und Mobilisierungsformen politischen Protestes wird es auch um demokratietheoretische Fragestellungen wie transnationale Gemeinschaftsbildung oder das Verhältnis von Demokratie und Überwachungskapitalismus gehen. Wer sich für eine Teilnahme interessiert, kann noch bis zum 26. Juli unter konferenz2019@protestinstitut.eu Vorschläge für Paper oder Panel einreichen – auch alternative Darstellungsformen wie Aufführungen sind explizit angefragt. Alle Informationen findet ihr hier im Call for Papers (deutsch / englisch) oder auf der Homepage des IPB.
Neueste Kommentare