 Die neue Ausgabe der Zeitschrift für Politische Theorie ist erschienen. Unter dem Themenschwerpunkt „Die Auflösung des liberalen Konsenses“ haben die beiden Herausgeber des Heftes, Karsten Schubert und Kolja Möller, eine Reihe spannender Beiträge versammelt. Maximilian Pichl analysiert in seinem Aufsatz Kämpfe um den Rechtsstaat aus einer historisch-materialistischen Perspektive, Daniel Keil widmet sich den Entwicklungen europäischer Staatlichkeit in der posthegemonialen Konstellation und Alexander Stulpe skizziert unter Rekurs auf den Resilienzbegriff ‚Elemente einer Politischen Theorie der Lebensfähigkeit liberaler Demokratien‘. Der Beitrag von Tim Wihl, den wir im Rahmen unserer bewährten Zusammenarbeit mit der Zeitschrift für Politische Theorie als Gegenstand für die Debatte auf dem Theorieblog ausgewählt haben und der damit hier open access verfügbar ist, beleuchtet das Phänomen der Demonstration in ihrem Verhältnis zur Revolte und stellt davon ausgehend ‚vorläufige Überlegungen zu einer politisch-juristischen Theorie der Demonstration in der liberalen Demokratie‘ an. Neben diesen Abhandlungen zum Themenschwerpunkt diskutiert Tamara Jugov in ihrem Beitrag die Frage, wann eine Utopie als hinreichend realistisch ausgezeichnet werden kann. Schließlich findet sich unter der Rubrik ,Ideengeschichtliche Fundstücke‘ ein Wiederabdruck einer ,in Vergessenheit geratenen‘ und ,erst vor kurzem in der Forschung wiederentdeckt[en]‘ Vortragsfassung des Textes „Der Beamte im sozialen Volksstaat“ von Hermann Heller, wie Marcus Llanque in seiner Einleitung zu diesem Wiederabdruck herausstellt.
Die neue Ausgabe der Zeitschrift für Politische Theorie ist erschienen. Unter dem Themenschwerpunkt „Die Auflösung des liberalen Konsenses“ haben die beiden Herausgeber des Heftes, Karsten Schubert und Kolja Möller, eine Reihe spannender Beiträge versammelt. Maximilian Pichl analysiert in seinem Aufsatz Kämpfe um den Rechtsstaat aus einer historisch-materialistischen Perspektive, Daniel Keil widmet sich den Entwicklungen europäischer Staatlichkeit in der posthegemonialen Konstellation und Alexander Stulpe skizziert unter Rekurs auf den Resilienzbegriff ‚Elemente einer Politischen Theorie der Lebensfähigkeit liberaler Demokratien‘. Der Beitrag von Tim Wihl, den wir im Rahmen unserer bewährten Zusammenarbeit mit der Zeitschrift für Politische Theorie als Gegenstand für die Debatte auf dem Theorieblog ausgewählt haben und der damit hier open access verfügbar ist, beleuchtet das Phänomen der Demonstration in ihrem Verhältnis zur Revolte und stellt davon ausgehend ‚vorläufige Überlegungen zu einer politisch-juristischen Theorie der Demonstration in der liberalen Demokratie‘ an. Neben diesen Abhandlungen zum Themenschwerpunkt diskutiert Tamara Jugov in ihrem Beitrag die Frage, wann eine Utopie als hinreichend realistisch ausgezeichnet werden kann. Schließlich findet sich unter der Rubrik ,Ideengeschichtliche Fundstücke‘ ein Wiederabdruck einer ,in Vergessenheit geratenen‘ und ,erst vor kurzem in der Forschung wiederentdeckt[en]‘ Vortragsfassung des Textes „Der Beamte im sozialen Volksstaat“ von Hermann Heller, wie Marcus Llanque in seiner Einleitung zu diesem Wiederabdruck herausstellt.
Wir freuen uns sehr, dass Rieke Trimçev von der Universität Erlangen-Nürnberg mit einem Kommentar zum Beitrag von Tim Wihl die ZPTh-Debatte im Folgenden eröffnen wird, worauf wiederum eine Replik des Autors folgt. Wie immer sind alle herzlich eingeladen, in den Kommentarspalten mitzudiskutieren! Wir wünschen eine gute Lektüre und übergeben nun das Wort an Rieke Trimçev.
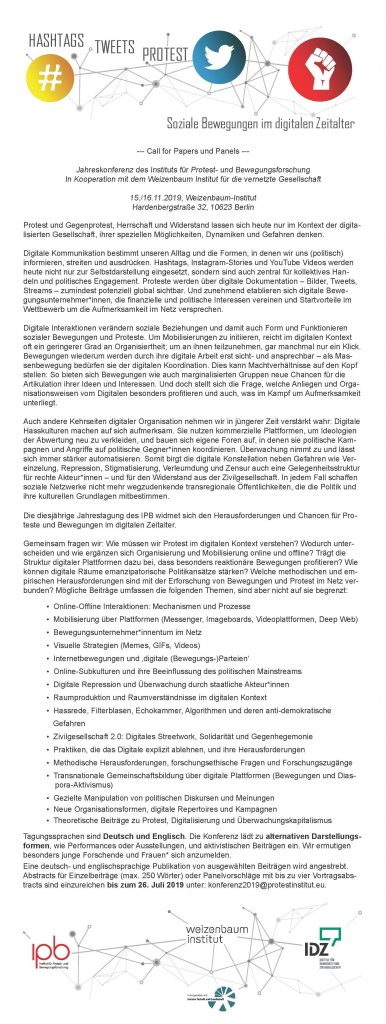
Neueste Kommentare