Am heutigen 11. März hätte Cornelius Castoriadis seinen hundertsten Geburtstag gefeiert. Damit ist ein Anlass für den vorliegenden Schwerpunkt gegeben. Das anhaltende und ausdifferenzierte (wenn auch nicht immer weithin sichtbare) Rezeptionsinteresse an Castoriadis‘ Werk und Denken liefern zudem auch einen mehr als überzeugenden Grund dafür, sich mit dessen unterschiedlichen Facetten und Anschlussmöglichkeiten auseinanderzusetzen.
Zweifellos sind Castoriadis‘ umfangreiche Schriften im Vergleich zu anderen Denker:innen, mit denen sich seine Wege etwa im Kontext von Socialisme ou Barbarie (wie Claude Lefort und Jean-François Lyotard, siehe Poirier 2019), seiner Tätigkeit an der EHESS (wie Jacques Derrida) oder im Umfeld der radikalen Demokratietheorie (wie Chantal Mouffe) kreuzten, bislang weniger umfangreich rezipiert worden. In der Tat ist Castoriadis’ Werk, aus einer links-libertären Strömung der französischen Linken kommend, in der deutschen Theorielandschaft nur spät und dann zögerlich zur Kenntnis genommen worden. Am fehlenden Zugang zu englischsprachigen Ausgaben seiner Schriften kann es allerdings nicht gelegen haben: So liegen schon seit 1988 drei umfangreiche Bände seiner Political and Social Writings bei University of Minnesota Press in englischer Übersetzung vor. Die deutsche Übersetzung seines Hauptwerks, Gesellschaft als imaginäre Institution, 1990 bei Suhrkamp erschienen, hat im deutschsprachigen Raum ebenfalls kaum dazu geführt, Castoriadis als jene wichtige Stimme in Debatten um kritische Theorie und radikale Demokratie zu etablieren, als die er auf internationaler Ebene seit mindestens den 70er Jahren weithin bekannt geworden ist.
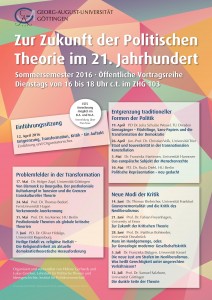
Neueste Kommentare