Die Veröffentlichung von Foucaults viertem Band der Geschichte der Sexualität, Die Geständnisse des Fleisches (Berlin: Suhrkamp 2019), wurde von der Foucault-Community und der interessierten Öffentlichkeit gespannt erwartet. Vom lange unter Verschluss gehaltenen Band erhofft sich die Leser_innenschaft neue Erkenntnisse nicht nur zum Thema des Buches – die Reflexionen der Kirchenväter bis Augustinus zu Sexualität und Lebensführung –, sondern zu Foucaults Werk im Allgemeinen und den großen Fragen nach Macht, Freiheit und Kritik, die dessen Rezeption bestimmen. Und tatsächlich bietet der Band überraschend neue Einsichten, in deren Lichte sich die herrschende Meinung zu Foucaults Freiheits- und Kritikbegriff als falsch herausstellt. Heute ist die These verbreitet, dass Foucaults Arbeiten zur antiken Ethik und parrhesia als Beitrag zu einem normativen Freiheitsbegriff gewertet werden können. Dagegen zeigt Die Geständnisse des Fleisches, dass die für Foucault und unsere Gegenwart relevante Freiheit, die Fähigkeit zur reflexiven Selbst- und Machtkritik, ihren Ursprung in den Subjektivierungen des frühen Christentums hat, das Subjektivität zum ersten Mal an kritische Machtreflexion koppelt. (mehr …)
Lesenotiz
Die Zukunft der Solidarität – (keine) zwei Meinungen
„Solidarität“ ist, nicht zuletzt im Kontext der diversen ‚Krisen‘ der jüngeren Vergangenheit, in aller Munde und erfährt auch aus politik- bzw. sozialwissenschaftlicher Perspektive (wieder) zunehmend Aufmerksamkeit. Deshalb kann es nicht überraschen, dass auch Heinz Budes jüngst unter dem Titel „Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“ (Hanser 2019, 176 Seiten) veröffentliche Überlegungen eine rasche Rezeption erfahren haben. Hier auf dem Theorieblog schlägt sich dies darin nieder, dass wir mit einer ‚doppelten‘ Lesenotiz von Stefan Wallaschek und Marie Wachinger gleich zwei Perspektiven auf Budes Buch bekommen. Wie immer dürfen natürlich aber auch hier weitere Eindrücke gerne im Kommentarbereich ergänzt werden.
Lesenotiz: „Zeit der Prävention. Eine Genealogie“
Es ist zu einem gängigen Klischee geworden, die Probleme der Prävention durch Rekurs auf Science-Fiction Filme wie „Minority Report“ oder „Gattaca“ zu illustrieren. In einer fernen und irgendwie düster-ungemütlichen Zukunft sehen wir hier männliche Helden mit den Zumutungen konfrontiert, die von Regimen der gesundheitlichen bzw. kriminologischen Prävention ausgehen. Die präzisen Vorhersagen künftiger Ereignisse dienen mächtigen Institutionen dazu eine Tyrannei der Zukunft zu organisieren, in der das antizipierte Ereignis zur Ursache gegenwärtigen Handelns wird. Die Filme operieren – wie die Prognosetechniken, die sie zeigen – mit Zukunftsszenarien, um eben diese inszenierte Zukunft noch abzuwenden. Die Filme sollen einen kritischen Effekt bewirken, der die Hoffnungen auf die Tugenden der Prävention, mit ihren möglichen Nebenfolgen konfrontiert. Zugleich wiegen die Filme ihre Zuschauer_innen aber auch in der trügerischen Hoffnung, dass es sich eben um Science Fiction handelt; also eine Zukunft, die wenn sie überhaupt eintreten sollte, noch in weiter Ferne liegt. Damit verschleiern sie, dass Prävention bereits im Hier und Jetzt eine ungemein wirkmächtige Sicherheitstechnik geworden ist, die trotz ihrer kaum zu bestreitenden positiven Wirkungen, auch eine Reihe von negativen Folgen mit sich bringt. Mathias Leanzas 2017 im Velbrück Verlag erschienene Dissertationsschrift über die Geschichte insbesondere medizinischer Vorbeugungstechniken wechselt demgegenüber das Genre. Leanza veranschaulicht die Probleme der Prävention nicht durch Rückgriff auf Science Fiction, sondern auf deren historische Ursprünge und Verlaufsformen. (mehr …)
Zwischen Abenddämmerung und Morgenröte – eine Replik auf Frank Nullmeier
In seinem Text „Legitimationsprobleme des Global Governance Systems. Michael Zürns Theorie der globalen Politik“ hat Frank Nullmeier sich vor zwei Wochen mit Michael Zürns bei Oxford University Press erschienener Monographie „A Theory of Global Governance“ auseinandergesetzt. Nun hat Michael Zürn auf dem Blog des Wissenschaftszentrum Berlin „Orders Beyond Borders“ geantwortet. Hier (und bei OBB hier) die ausführliche Erwiderung:
Frank Nullmeier hat sich im Theorieblog kritisch mit meiner „Theory of Global Governance“ (TOGG) auseinandergesetzt. Über seine kluge Kritik freue ich mich und möchte im Gegenzug darauf reagieren. Im besten Fall regt die Auseinandersetzung weitere Beiträge an. Frank Nullmeiers Beitrag beruht auf einer äußerst konzisen und fairen Zusammenfassung der Argumentation. Besonders schmeichelhaft ist es dabei, wenn er die Theoriekonstruktionsprinzipien von Jürgen Habermas‘ „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“ als Vergleichsfolie heranzieht. Schmeicheleien sind aber oft zweischneidig und so auch hier. Bei einem solchen Vergleich werden nämlich Defizite nur allzu gut sichtbar. Frank Nullmeier hebt in seiner Kritik v.a. drei Punkte hervor. Zum einen erweist sich der Anspruch von TOGG vor dem Habermasschen Hintergrund als geradezu bescheiden. Es handelt sich nur um eine Theorie des (globalen) politischen Systems und stellt keine Theorie der (kapitalistischen) Weltgesellschaft dar. Dadurch – so der zentrale Kritikpunkt von Frank Nullmeier – würden aber andere gesellschaftliche Systeme und mithin gewaltbasierte und interessengeladene Macht- und Herrschaftsbeziehungen ausgeblendet. Zweitens werde der Begriff der Autorität überdehnt, indem er durch das Konzept der Aufforderungen (requests) weit gefasst wird. Politische Systeme arbeiten aber nach Easton und Nullmeier üblicherweise mit Anweisungen (commands). Und dann ist da auch noch die Eule der Minerva, die ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt. Ich möchte in dieser Reaktion kurz auf diese drei wichtigen Kritikpunkte eingehen. (mehr …)
Lesenotiz zu Hannah Arendts „Sechs Essays/Die verborgene Tradition“
Lesenotiz zu Hannah Arendt: Sechs Essays/Die verborgene Tradition (= Kritische Gesamtausgabe/Complete Works. Critical Edition, Bd. 3, Göttingen 2019).
Für Politische Theoretiker*innen, die sich für Hannah Arendt interessieren, hatte das lange Warten im Herbst vergangenen Jahres endlich ein Ende: Die Veröffentlichung der Kritischen Arendt-Gesamtausgabe ist angelaufen. Aber hat sich das Warten auch gelohnt? Nach dem fulminanten Auftakt durch Band 6 The Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buches, gibt der gerade erschienene Band 3 Sechs Essays/Die verborgene Tradition nun weiteren Aufschluss über diese Frage. Er ist Anfang Januar recht zeitnah nach dem Marx-Band als zweites Buch des voluminösen, insgesamt auf 17 Ausgaben angelegten Projekts erschienen. Laut Editionsplan sind die Sechs Essays zugleich der einzige für 2019 geplante Band. (mehr …)
Lesenotiz zu Hannah Arendts „The Modern Challenge to Tradition“
Lesenotiz zu Hannah Arendt: The Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buches (= Kritische Gesamtausgabe/Complete Works. Critical Edition, Bd. 6, Göttingen 2018).
Der Band The Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buches markiert den Auftakt für die Publikation der historisch-kritischen Gesamtausgabe des Werkes von Hannah Arendt.Dabei handelt es sich um den sechsten Band einer in siebzehn thematische Komplexe gegliederten Werkschau. Und man kann schon jetzt sagen, dass dem Herausgeber/innen-Team um Barbara Hahn, Thomas Wild, Anne Eusterschulte, Eva Geulen, Hermann Kappelhoff, Patchen Markell und Annette Vowinckel mit diesem Band im Besonderen und der Konzeption der Gesamtausgabe im Allgemeinen ein großer Coup gelungen ist, der in jeder Hinsicht begeistert: die editorische Gründlichkeit ist beeindruckend, die Kommentierung in Tiefe und Länge sehr klug ausbalanciert, die Darstellung der Textfassungen übersichtlich, die Orientierung im Band gestaltet sich für den Leser/die Leserin problemlos und die für 2019 in Aussicht gestellte Digitalausgabe, die computergestützte Analysen der Texte Arendts ermöglichen soll, wirkt auf Arendt-Forscher/innen gleichsam elektrisierend. (mehr …)
Beerbt der Linkspopulismus die Sozialdemokratie? Lesenotiz zu Chantal Mouffes „For a Left Populism“
Chantal Mouffe tritt immer wieder als Fürsprecherin eines „linken Populismus“ und als Stichwortgeberin linker Parteien und Bewegungen wie Podemos, Momentum und La France Insoumise in Erscheinung. In Interviews und Texten bietet sie ebenso griffige wie radikal anmutende Erklärungen, die aktuelle Reizthemen vor allem der linken politischen Diskussion verbinden: Neoliberalismus, Postdemokratie, Aufstieg der Rechten, Krise der Sozialdemokratie und linke Strategie. In ihrem jüngsten Buch For a Left Populism, das soeben auch auf Deutsch bei Suhrkamp erschienen ist, wiederholt sie nun ihr Plädoyer für einen populistischen Ausweg aus der gegenwärtigen Misere. (mehr …)
Entmythologisierung. Zur Neuausgabe der „Deutschen Ideologie“ (MEGA2 I/5)
Im kollektiven Gedächtnis des Marxismus sowie der Marx- und Engelsforschung hat die Deutsche Ideologie – genauer jenes Textkonvolut, das unter dieser Überschrift firmierte – immer einen besonderen Platz eingenommen. Mit der Deutschen Ideologie, wie sie im dritten Band der Marx-Engels-Werke (MEW) lange Zeit wirkmächtig und kanonisch überliefert wurde, assoziierte man vor allem das berühmte Feuerbach-Kapitel, das nicht nur dem Traditionsmarxismus als die Geburtsstunde des sogenannten „historischen Materialismus“ galt. Zwar hatte man schon seit Längerem geahnt, dass Kapitel I. Feuerbach das Ergebnis einer editions- und wissenspolitischen Konstruktion war und man wusste auch, dass möglicherweise nicht so sehr der große Philosoph Feuerbach, sondern stärker noch der gespenstische Stirner die Hand an der „Wiege des Marxismus“ (Wolfgang Eßbach) hatte; gleichwohl wirkte der Mythos von einem abgeschlossenen, kohärenten und ursprünglichen „Werk“ oder Referenztext des „historischen Materialismus“ in weiten Teilen einer akademischen und politischen Öffentlichkeit fort.
Spätestens aber mit der Neuausgabe der Deutschen Ideologie innerhalb der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2 I/5) ist dieser Mythos als ein solcher offengelegt und sichtbar gemacht. Die HerausgeberInnen, Ulrich Pagel, Gerald Hubmann und Christine Weckwerth, haben daher mit dieser Neuausgabe nicht weniger geleistet als einen weiteren, mächtigen Schritt zur Entmythologisierung des Marxismus wie wir ihn bisher kannten. (mehr …)
Die Grenzen der Demokratie und die Frage nach demokratischen Grenzen
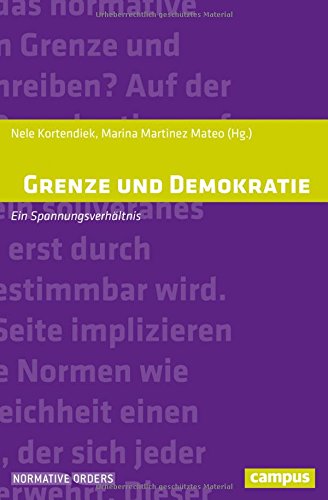 Nele Kortendiek und Marina Martinez Mateo (Hrsg.), 2017: Grenze und Demokratie. Ein Spannungsverhältnis. Frankfurt a.M.: Campus. ISBN 978-3-593-50725-5, 39,95€.
Nele Kortendiek und Marina Martinez Mateo (Hrsg.), 2017: Grenze und Demokratie. Ein Spannungsverhältnis. Frankfurt a.M.: Campus. ISBN 978-3-593-50725-5, 39,95€.
Der DVPW-Kongress 2018 wird die Frage der Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy im Kontext ihrer aktuellen Krisen stellen. Tenor des Call for Papers ist, dass Demokratie auf vielfältige Weise an ihre Grenzen stößt und dass zugleich diese Krisendiagnosen politikwissenschaftlich genauer betrachtet werden sollten, um in den Grenzgebieten der Demokratie vielleicht auch neue Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten. (mehr …)
Der halbe Marx und sein ganzes Jahrhundert. Lesenotiz zu Gareth Stedman Jones‘ „Karl Marx. Die Biographie“
In seiner intellektuellen Biographie Karl Marx möchte Gareth Stedman Jones, Historiker und jahrelanger Mitherausgeber der New Left Review, wie ein „Restaurator“ (S. 721) verfahren und all die dicken Schichten aus Marx-Bildern abtragen (d.h. ignorieren), um darunter den wahren „Karl“ zu entdecken. Dazu will er den damaligen Debatten genauso viel Beachtung wie dem Marx’schen Werk selbst schenken, um letzteres konsequent in seinen ideengeschichtlichen Entstehungskontext einbetten zu können. Da neben der Geschichte des Marx’schen Denkens auch die seines Lebens erzählt werden soll, ist das ein gewaltiges Unterfangen, das zu vielen Verkürzungen führen muss. So fokussiert sich Stedman Jones, ohne es mitzuteilen, eher auf den jungen Marx: 380 von 720 Seiten des Haupttexts behandeln den Zeitraum bis 1848/49, also die ersten sieben bis acht Jahre des Marx’schen Wirkens. Auch wenn sich hier ausgezeichnete Abschnitte etwa zur Doktorarbeit, zum Disput der Hegel-Interpreten Gans und Savigny, zur Bedeutung Ludwig Feuerbachs und zum von Marx in der 1848er Revolution empfohlenen Steuerboykott finden, sind die verbleibenden rund 35 Jahre und der Groß- und wahrscheinlich wichtigste Teil des Marx’schen Schaffens – darunter Das Kapital – relativ vernachlässigt. Von den fünfzehn Bänden, welche die ökonomische Abteilung der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) umfasst, war zu diesem Zeitpunkt keine Zeile geschrieben; von den 32 MEGA-Bänden mit Exzerpten und Notizen (mehr als die Hälfte davon noch nicht erschienen) nur die ersten sechs. Wie gelungen kann eine Restauration sein, wenn sie das magnum opus des ‚wiederhergestellten‘ Autors nicht zum Vorschein bringt? (mehr …)
Neueste Kommentare