Rezension zu Hent Kalmos und Quentin Skinners „Sovereignty in Fragments. The Past, Present and Future of a Contested Concept“, Cambridge University Press, 2010.
Der Begriff der Souveränität ist im Zuge der weltgesellschaftlichen Konstellation grundsätzlich in Frage gestellt: Ist der Begriff der Souveränität weiterhin geeignet, die politischen und rechtlichen Entwicklungen einzuordnen, zu beschreiben und verstehbar zu machen? Der von Hent Kalmo und Quentin Skinner herausgegebene Sammelband „Sovereignty in Fragments“ greift diese Debatte auf. In einer vorzüglichen Einleitung plädieren Kalmo und Skinner für einen interdisziplinären Dialog beim Nachdenken über Souveränität: da der Souveränitätsbegriff heute in so unterschiedlichen Bezügen verwendet werde, ließe sich nur durch einen solchen Dialog verhindern, dass man zentrale Bedeutungsdimensionen des Begriffs ausblendet und so ein unbrauchbares heuristisches Konzept erschafft – mit weitreichenden normativen Implikationen. Für die Politische Theorie bedeutet das, dass die rechts- und sozialwissenschaftlichen Diskurse das „Material“ für die Reflexion liefern; gleichzeitig heißt das aber, dass man auch bereit sein muss, sich von diesem „Material“ irritieren zu lassen.
Ein Meister des Irritierens ist seit Jahren Stephen Krasner. Die Kernthese seines einschlägigen Souveränitätsbuches war, dass es sich bei der Souveränität um organisierte Heuchelei handle. In seinem Beitrag für den Sammelband, „The durablitity of organized hypocrisy“ verteidigt er die unveränderte Gültigkeit dieser These. Nur wenige, als souverän erachtete Staaten haben historisch betrachtet alle drei Kernelement der Souveränität – internationale rechtliche Anerkennung, das Nicht-Unterworfensein unter externe Autoritätsstrukturen und die effektive Kontrolle über das eigene Staatsterritorium – dauerhaft für sich beanspruchen können. Wenngleich also die „logic of appropriateness“ des Souveränitätsbegriffs nicht deckungsgleich mit der „logic of consequences“ ist, geht Krasner davon aus, dass Souveränität als „Schlüsselnorm“ (Salzborn) der internationalen Politik noch lange Zeit bestehen bleibt. Denn die „key actors in the system, those that might have the power to create new normative structures, have not had an incentive to do so.“ Entsprechend kommt Krasner zu dem Schluss, dass „sovereignty has worked very imperfectly but it has still worked better than any other structure that decision-makers have been able to envision.“ (112)
Quentin Skinner liefert in seiner Genealogie des souveränen Staates den politiktheoretischen Unterbau für Krasners Annahme. Skinner entfaltet die These, dass „we can scarcely hope to talk coherently about the nature of public power without making reference to the idea of the state as a fictional or moral person distinct from both rulers and ruled.“ (45) Nur durch den Rückgriff auf den souveränen Staat als persona ficta seien wir in der Lage, Verpflichtungen einzugehen, die weder eine Regierung allein noch eine einzelne Generation von Bürgern auf sich nehmen könnte. Folglich sollten wir nach Skinner erkennen, “that one reason why states are likely to remain powerful actors in the contemporary world is that they will outlive us all.“ (46)
Antonio Negri und Neil MacCormick sehen das ganz anders: Neil MacCormick, 2009 verstorben, argumentiert mit Blick auf die EU, dass die politischen und rechtlichen Veränderungen im Zuge der europäischen Integration zu einem „abondenment of key attributes of sovereignty as this was classically understood“ (151) führten. Sowohl im Hinblick auf die Souveränität nach Innen als auch nach Außen mache die „’post-sovereignty’ thesis“(168) Sinn. Antonio Negri geht ebenfalls von der Beobachtung aus, dass die globalen politischen und rechtlichen Entwicklungen den Begriff und die Norm der Souveränität „de-structured“ haben. Souveränität ist „no longer defineable in Westphalian terms.“ (206) Aus dieser Situation jedoch erwächst der politischen Theorie die große Herausforderung, das Konzept der Souveränität auch in moralisch- und politisch-normativer Hinsicht zu dekonstruieren und jene Aspekte zu bewahren, ohne die sich politische Selbstbestimmung nicht denken lässt. Ein erster Schritt auf diesem Wege ist die „metaphysical illusion of the power of exception“, die lange Zeit die Konnotation des Souveränitätsbegriff dominierte, streng von der Idee der „constituent power“ zu trennen: „exception does not represent the ontological essence of power but simply the eventual brutality of the sovereign decision, its ‚terrorism’ – as Kant put it.“ (212) Wenn man diese Trennung vollzieht, dann wird man erkennen können, dass „beyond sovereignty lies the common power of singularities in the determination of the forms of communal life.“ (221) Kurzum: jenseits der Souveränität liegt die Möglichkeit des „commonwealth“, wie Negri sein bislang letztes, mit Michael Hardt zusammen publiziertes Buch überschrieben hat.
Auch das Ende des Bandes ist fulminant: Martti Koskenniemi, einer der Großmeister des internationalen Rechts, fasst auf beeindruckende Weise den interdisziplinären „excess of sovereignty“ (225) zusammen. Er beginnt mit der rechtswissenschaftlichen Perspektive auf den Souveränitätsbegriff und zeichnet dann nach, wie diese Perspektive sich immer auch schon historisch und rechtshistorisch zu argumentieren genötigt fühlt. Diese historische Perspektive kippt nach geraumer Zeit ins Soziologische, weil sie sich auf die „search for the group of human beings“ begeben muss, „whom present theory and practice lift into the position of the ‚ultimate’ decision-makers.“ (229) Aus der soziologischen Betrachtung erwächst nicht minder rasch die Notwendigkeit, mit einer politischen Betrachtung anzuschließen, d.h. „directly addressing struggle and desire, the openness and closure of the polis.“ (231) Diese politische Dimension greift Koskenniemi auf und argumentiert, dass „sovereignty persists as an instrument of analysis and polemics“ (239). Analyse und Polemik sei von ungemeiner Bedeutung, da die politische Herausforderung sich verändert habe. Die Gefahr liege heute nicht mehr so sehr in der Logik chauvinistisch agierenden souveränen Nationalstaaten begründet, die die Welt in zwei verheerende Kriege führte und gegen die bereits wichtige und gut begründete Kritik vorgebracht wurde. Die Herausforderung bestehe heutzutage im Managementjargon von global governance, der mit der Konzentration auf der „production of good outcomes“ der Idee von „selfhood and relationships to others“ (240) kaum noch Raum lässt. Aus diesem Grund müsse die „bright side“ der Souveränität hervorgehoben werden, die Koskenniemi im „collective life as a project“ identifiziert. Konkret liegt die „bright side“ der Souveränität darin, ein „set of institutions or practices“ ausgebildet zu haben, „in which the forms of collective life are constantely imagined, debated, criticized and reformed, over and again.“(241)
Man sieht sehr schnell, worin das Fruchtbare eines so gearteten kritischen Anschlusses an den Souveränitätsbegriff liegen kann: Souveränität wird zur Losung für eine demokratisch-politische Gestaltung der Weltgesellschaft. Was diese Stoßrichtung angeht, so ist Koskenniemi grundsätzliche auf einer Linie mit so unterschiedlichen Autoren wie Skinner oder Negri. Doch damit beginnen die Probleme erst: wie soll diese demokratisch-politische Gestaltung idealiter aussehen? Wo ist der Ort der Demokratie und Politik in der postnationalen Konstellation? Wer sind die politischen Sprecher im Dienste der Souveränität? Wer hat das letzte Wort und trägt damit die Letztverantwortung? Die (demokratischen) Staaten, die transnationale Öffentlichkeit, supranationale Institutionen oder die multitude? Welche institutionellen Formen sind dafür denkbar, wünschbar und praktikabel?
Jenseits des demokratisch-kämpferischen Pathos bleibt in all diesen Anschlussversuchen die Frage offen, wie mit dem Begriff der Souveränität auf die politischen und rechtlichen Herausforderungen zu antworten ist. Es drängt sich der leise Verdacht auf, dass die Vielzahl der historisch tradierten und ambivalenten Komponenten und Konnotationen des Begriffs nicht so recht in Einklang zu bringen sind mit dem komplexen Anforderungsprofil einer plausiblen Antwort auf das „Wie“ der demokratisch-politischen Gestaltbarkeit der Weltgesellschaft – und eben neue Begriffe und Beschreibungen daher nötig werden. Unabhängig davon aber wird klar, dass die Frage nach der Souveränität im 21. Jahrhundert komplex ist und nicht abschließend geklärt werden kann. Empirisch-sozialwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Forschungsdiskurse haben den Begriff zwar in Frage gestellt, aber sich von ihm zu verabschieden, ist nicht so leicht: : „[T]he time of sovereignty“, schreibt Martti Koskenniemi, „is hardly over“ (222).
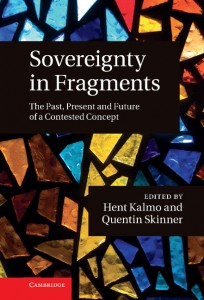
Nur ein Hinweis zum Weiterlesen: Gute Gründe, diesem Schlusssatz etwas kritischer gegenüberzustehen, liefert das Buch von Daniel Loick mit dem klasischen Titel „Kritik der Souveränität“, in dem die dem Souveränitätsbegriff inhärente Ironie, Gewalt gewaltsam einzuhegen, bis in ihre Fortsetzungen in unserem Rechtsdenken verfolgt wird.